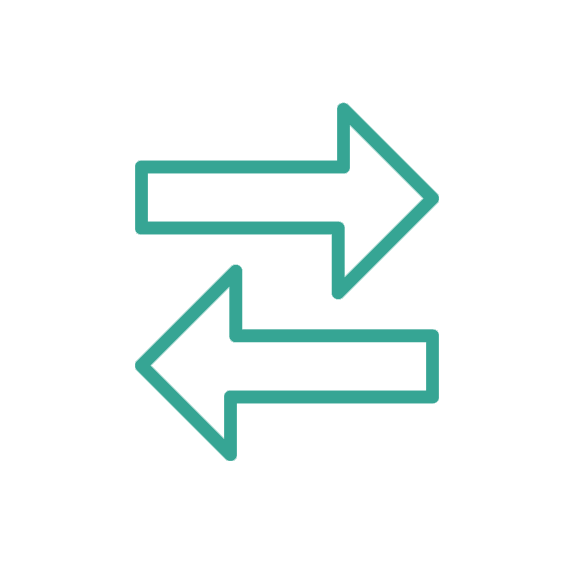 Interaktion
Interaktion
Vorschläge der Aktion Artikel 16
- Qualitätssteigerung der Empfangskultur (First five minutes)
- 1:1 (2:1)-Betreuung zur Vermeidung von Zwang
- Haltetechniken / Festhalten statt Fixierung
- Tiergestützte Therapieformen
- Gemeinsame Morgenrunden und Mahlzeiten – im Sinne der gemeinsamen Tagesgestaltung
Fokussierung auf Stärken und Entwicklung von Skills
(Strengths based and skill building – Teil des Traumainformierten Ansatzes (Trauma informed practice, TIP))
Beschreibung
Nutzer*innen werden dabei unterstützt, bestehende Stärken zu identifizieren und ihre Resilienz (Widerstandsfähigkeit) und Bewältigungsmechanismen (Coping-Strategien) (weiter-) zu entwickeln. Skills umfassen Techniken zur Erfassung von Triggern, zur Beruhigung, zur „Zentrierung“, sowie zum Anwesendbleiben. Es ist essenziell, dass auch die Mitarbeitenden diese Skills und Werte erlernen.
Adressat*innen
Mitarbeitende inkl. Führungspersonal
Nutzer*innen
Evidenznachweise
Centre for Addiciton and Mental Health in Toronto, Canada:
Reduzierung der Anwendung von mechanischer Fixierung (von 4.2% auf 2.2% innerhalb eines Jahres)
Reduzierung der Anwendung von Isolationsmaßnahmen (von 5,3% auf 3,4% innerhalb eines Jahres )
Reduzierung der Anwendung von Zwangsmedikation (von 4,8% auf 3,0% innerhalb eines Jahres)
Quellennachweise
Arthur et al. (2013) Trauma-informed Practice Guide
Gooding, P. et al. (2018) Alternatives to Coercion in Mental Health Settings: A Literature Review, Melbourne: Melbourne Social Equity Institute, University of Melbourne.
Möglichkeiten der Wahl, Zusammenarbeit und Verbindung
(Opportunity for choice, collaboration, and connection – Teil des Traumainformierten Ansatzes (Trauma informed practice, TIP))
Beschreibung
Eine sichere Umgebung kann ein Wissen um Wirksamkeit, Selbstbestimmung, Würde und persönlicher Kontrolle ermöglichen. Das Personal kommuniziert offen und Machtdifferenzen (zwischen Mitarbeitenden und Nutzer*innen) werden ausgeglichen. Gefühle und Bedarfe können ohne Angst vor Verurteilung geäußert werden. Es stehen unterschiedliche Unterstützungsoptionen zur Auswahl. Außerdem bleiben die Beziehungen zum sozialen Netzwerk erhalten.
Wirkweise
Die Erfahrung von selbstbestimmter Wahl, Zusammenarbeit und Verbindung ist heilsam für Menschen, die Trauma erlebt haben/ erleben.
Adressaten
Mitarbeitende inkl. Führungspersonal
Nutzer*innen
Evidenznachweise
Centre for Addiciton and Mental Health in Toronto, Canada:
Reduzierung der Anwendung von mechanischer Fixierung (von 4.2% auf 2.2% innerhalb eines Jahres)
Reduzierung der Anwendung von Isolationsmaßnahmen (von 5,3% auf 3,4% innerhalb eines Jahres )
Reduzierung der Anwendung von Zwangsmedikation (von 4,8% auf 3,0% innerhalb eines Jahres)
Quellen
Arthur et al. 2013 Trauma-informed Practice Guide
Gooding, P. et al. (2018) Alternatives to Coercion in Mental Health Settings: A Literature Review, Melbourne: Melbourne Social Equity Institute, University of Melbourne.
Betonung auf Sicherheit und Vertrauen
(Emphasis on Safety and Trustworthiness – Teil des Traumainformierten Ansatzes (Trauma informed practice (TIP))
Beschreibung
Feste Willkommensrituale, die Vermittlung verständlicher Informationen bezüglich der Angebote und deren Abläufe, zusätzlich zu einem sicheren Umfeld, machen die Aufnahme auf eine Station weniger bedrohlich. Auch gemeinsam erstellte Krisenpläne und regelmäßige Gespräche helfen dabei, ebenso wie die systematische Berücksichtigungen der Bedürfnisse der Mitarbeitenden. Die Mitarbeitenden erhalten Fortbildungen, Supervisionen und Unterstützung, um zu lernen sich auch um sich selbst zu kümmern.
Wirkweise
Physische, emotionale und kulturelle Sicherheit ist für Nutzer*innen essenziell.
Adressat*innen
Mitarbeitende inkl. Führungspersonal
Nutzer*innen
Evidenznachweise
Centre for Addiciton and Mental Health in Toronto, Canada:
Reduzierung der Anwendung von mechanischer Fixierung (von 4.2% auf 2.2% innerhalb eines Jahres)
Reduzierung der Anwendung von Isolationsmaßnahmen (von 5,3% auf 3,4% innerhalb eines Jahres )
Reduzierung der Anwendung von Zwangsmedikation (von 4,8% auf 3,0% innerhalb eines Jahres)
Quellen
Arthur et al. 2013 Trauma-informed Practice Guide
Gooding, P. et al. (2018) Alternatives to Coercion in Mental Health Settings: A Literature Review, Melbourne: Melbourne Social Equity Institute, University of Melbourne.
Trauma-Achtsamkeit
(Trauma Awareness – Teil des Traumainformierten Ansatzes (Trauma informed practice (TIP))
Beschreibung
Mitarbeitende und Nutzer*innen sind sich der Häufigkeit von Traumata und deren Folgen für das Leben der betroffenen Menschen, sowie der verschiedenen Möglichkeiten ihrer Bewältigung, bewusst. Zentral ist die Vermeidung von Retraumatisierung und Recovery von den Traumatisierungen.
Adressat*innen
Mitarbeitende inkl. Führungspersonal
Evidenznachweise
Centre for Addiciton and Mental Health in Toronto, Canada:
Reduzierung der Anwendung von mechanischer Fixierung (von 4.2% auf 2.2% innerhalb eines Jahres)
Reduzierung der Anwendung von Isolationsmaßnahmen (von 5,3% auf 3,4% innerhalb eines Jahres )
Reduzierung der Anwendung von Zwangsmedikation (von 4,8% auf 3,0% innerhalb eines Jahres)
Quelle
Gooding, P. et al. (2018) Alternatives to Coercion in Mental Health Settings: A Literature Review, Melbourne: Melbourne Social Equity Institute, University of Melbourne.
Deeskalationstechniken
(de-escalation techniques)
Beschreibung
Techniken zur Deeskalation von Konfliktsituationen im Krankenhaus oder in Pflegeeinrichtungen, die eingesetzt werden, um die Anwendungshäufigkeit von Zwang zu reduzieren. Das Personal erhält hierzu spezielle Schulungen, wobei es unterschiedliche Techniken gibt.
Ein Beispiel:
Festhalten statt Fixieren/ 4-Stufen-Immobilisationskonzept (4SIK): beinhaltet neben speziellen Haltetechniken eine durchgehende und klare Kommunikation. Ziel hierbei ist es, eine gemeinsame Lösung zu finden, die therapeutische Beziehung möglichst aufrecht zu erhalten und eine weitere freiheitsentziehende Maßnahme zu verhindern.
Wirkweise
Das Erlernen und Anwenden von alternativen Strategien, statt der Anwendung von Zwang, ermöglicht flexiblere und adäquate Reaktionen der Mitarbeitenden auf Konflikte und somit eine Abkehr von Zwang.
Adressat*innen
Führungspersonal und Mitarbeitende der Station
Evidenznachweise
Es gibt positive Reaktionen der Mitarbeitenden auf das Erlernen und Anwenden der Deeskalationstechniken. Deeskalationstechniken sind damit ein wichtiger Faktor in der Reduzierung von Isolierungsmaßnahmen in einer geschlossenen Station. Das Erlernen und die Anwendung von Deeskalationstechniken wurden als dringend notwendig von Mitarbeitenden angesehen, um Zwang zu reduzieren.
4SIK führte zu Reduzierung von Fixierungen in Deutschland und wurde positiv von Mitarbeitenden und Nutzer*innen evaluiert
Quellen
Gooding, P. et al. (2018) Alternatives to Coercion in Mental Health Settings: A Literature Review, Melbourne: Melbourne Social Equity Institute, University of Melbourne.
Staude, A. (2016) “Fremdsein überwinden”. Kompetenzen der psychiatrischen Pflege in Praxis –Management – Ausbildung – Forschung. Herausgeber: Michael Schulz et al. Verlag Forschung & Entwicklung / Dienstleistung Pflege, Fachbereich Gesundheit, Berner Fachhochschule
Nutzung von festgelegten Instrumenten zur Reduzierung von Zwang und Isolierungsmaßnahmen
(Use of seclusion and restraint reduction tools – Teil der Sechs Kern-Strategien zur Reduzierung der Anwendung von Isolierung und Zwangsmaßnahmen)
Beschreibung
Werkzeuge zur Einschätzung des individuellen Risikos für die Anwendung von Gewalt und bereits erlebter Zwangsmaßnahmen. Erlebte Traumata werden erfasst, nicht-diskriminierende Sprache wird verwendet, sinnvolle ergo-/ beschäftigungstherapeutische Interventionen werden angeboten, sowie Änderungen der Umgebung zur Steigerung des Wohlbefindens durchgeführt. Es werden Aktivitäten angeboten, die Nutzer*innen Skills zur Selbstregulation von Emotionen vermitteln und Deeskalations-Pläne erstellt.
Wirkweise
Nutzung von individuellen Einschätzungen und Ressourcen zur Aggressions- und Gewaltprävention. Hierbei hilfreich sind auch erlernte Skills zur Emotionsregulation.
Adressat*innen
Mitarbeitende der jeweiligen Station
Einrichtungen und deren Leitung
Evidenznachweise
Sechs empirische Studien sowie eine sog. „Grey-literature“-Studie berichten über eine signifikante Reduzierung von Zwang. Die „Six Core Strategies“ fanden Anwendung im Krankenhauskontext (Erwachsenenpsychiatrie, in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, und in der Forensischen Psychiatrie).
Quellen
Six Core Strategies (National Association of State Mental Health Program Directors (NASMHPD) 2006)
Gooding, P. et al. (2018) Alternatives to Coercion in Mental Health Settings: A Literature Review, Melbourne: Melbourne Social Equity Institute, University of Melbourne.
Unterstützte Entscheidungsfindung
(supported decision-making)
Beschreibung
Unterstützte Entscheidungsfindung ermöglicht das selbstbestimmte Entscheiden auch in akuten Krisenzeiten und mit Unterstützung. Grundlegend thematisiert wird sie u.a. in den Allgemeinen Bemerkungen Nr. 1 des UN-Fachausschuss (29.).
Beispiele der unterstützten Entscheidungsfindung:
1) Das argentinische Nationale Psychische Gesundheitsgesetz (National Mental Health Law) von 2010, das den nötigen rechtlichen Rahmen zur Umsetzung von unterstützter Entscheidungsfindung schafft.
2) Das schwedische Persönliche Umbudsperson (personligt ombud) Programm
Wirkweise
Im Zentrum der unterstützten Entscheidungsfindung steht der Willen und die Präferenzen der betroffenen Person. Der Schutz der Autonomie betroffener Menschen und das Recht auf körperliche Unversehrtheit sind dabei die u.a. entscheidenen Maßstäbe eine menschenrechtskonformen psychosozialen Unterstützung. Obwohl dieser Ansatz sehr wichtig im Bezug auf die Wahrung von Menschenrechten ist, gibt es bislang nur ungenügende Forschung.
Adressat*innen
Politik – Schaffung des rechtlichen Rahmens
Kliniken/ psychiatrische Einrichtungen
Mitarbeitende
Quellen
Mayrhofer, H. (2014): Modelle unterstützter Entscheidungsfindung Beispiele guter Praxis aus Kanada und Schweden, IRKS Working Paper 16
Gooding, P. et al. (2018) Alternatives to Coercion in Mental Health Settings: A Literature Review, Melbourne: Melbourne Social Equity Institute, University of Melbourne.
Therapeutische Beziehung
(therapeutic relationship/ therapeutic alliance)
Beschreibung
Die würdevolle Beziehung zwischen Nutzer*innen und Mitarbeitenden, beeinflusst die Wahrnehmung von Zwang durch Nutzer*innen und Mitarbeitende: Die Verbesserung der Beziehung durch Gespräche, gegenseitigen Respekt und Supervision kann die Anwendung von Zwang verhindern.
Wirkweise
Eine gute Beziehung vermindert den Einsatz von Zwang. Handlungsweisen, die die Beziehung verbessern, können demnach den Einsatz von Zwang reduzieren.
Adressat*innen
Mitarbeitende
Nutzer*innen
Evidenznachweise
Krankenhauseinweisungen (auch freiwillige) wurden eher als Zwang empfunden, wenn die Beziehung zu den Therapeut*innen als negativ eingeschätzt wurde.
Quellen
Sheehan, K.A., et al. (2011) Perceived Coercion and the Therapeutic Relationship: A Neglected Association?
Cookson, A. et al. (2012) Relationship between aggression, interpersonal style, and therapeutic alliance during short-term psychiatric hospitalization. International Journal of Mental Health Nursing
Gewaltfreie Kommunikation
Beschreibung
Abkehr vom Strafgedanken und Hinwendung zum Schutzgedanken:
In den Gesprächen zwischen Mitarbeitenden und Nutzer*innen geht es darum, die gegenseitigen Bedürfnisse zu formulieren und anzuerkennen, sowie gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Es existieren klar formulierte Regeln und Verbote und als letzte Konsequenz auch die Möglichkeit des Behandlungsabbruchs.
Wirkweise
Die Bedarfe der Nutzer*innen und des Mitarbeitenden werden besser verstanden und es kann dementsprechend besser auf sie eingegangen werden.
Adressat*innen
Mitarbeitende
Nutzer*innen
Evidenznachweise
Ein Rückgang der Konflikte in den Züricher Polikliniken, die dieses Konzept umsetzten.
Quellen
Binggeli (2009) Nun werden wir nicht länger wie Kinder behandelt – Wie die Zürcher Polikliniken Sanktionen abschafften und die gewaltfreie Kommunikation einführten, Schwerpunkt – Soziale Arbeit im Suchtbereich
Psychiatrische Notfall-Teams
(psychiatric emergency response teams)
Beschreibung
Spezialisierte Teams in Krankenhäusern, die besonders darin geschult sind, mit Krisensituationen von Menschen so umzugehen, dass Zwangsmaßnahmen verhindert werden. Hierbei werden insbesondere verbale Deeskalationstechniken angewandt.
Wirkweise
Erfahrene, speziell geschulte Mitarbeitende sind eher in der Lage, die Anwendung von Zwang in Krisensituationen zu vermeiden.
Adressat*innen
Leitung – muss die nötigen Mittel für Bereitstellung eines solchen Teams in den Einrichtungen bereitstellen
Mitarbeitende
Quellen
Gaskin, C.J. et al. (2007) Interventions for reducing the use of seclusion in psychiatric facilities. Review of the literature. British Journal of Psychiatry
